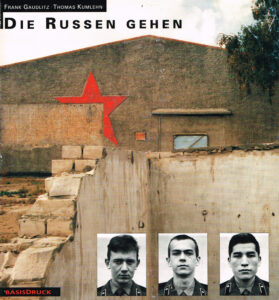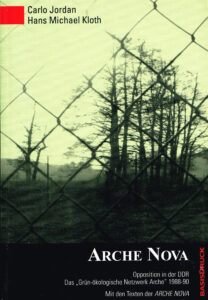Vorwort der Autorin
Ein kleines Lederetui ließ mein Großvater Dagobert Lubinski in seiner Gefängniszelle zurück, als er am Morgen des 18. Januar 1943 in den Wagen stieg, der ihn auf den Weg nach Auschwitz brachte. Das Täschchen, winziger als eine Streichholzschachtel, liegt vor mir auf dem Tisch. Ich nehme es in die Hand, fühle sein weiches Leder und versuche mir vorzustellen, wie die letzte Fahrt meines Großvaters verlaufen sein mag. Das kleine Etui enthält keine Nachricht darüber, aber es ist ein Band zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen mir und meinem Großvater, vielleicht der letzte Gegenstand, den er berührt hat, bevor sein Weg sich auf den Förderbändern des Todes verlor. Fotos seiner beiden Töchter stecken in der kleinen Lederhülle, zerknittert, vergilbt, tausendmal herausgenommen. Die pausbäckigen Kindergesichter meiner Mutter Nora und ihrer Schwester Hannah schauen mich an. Dahinter stecken noch andere kleine Bilder: Die beiden Mädchen, sieben und acht Jahre alt, mit ihrer Mutter, deren Kopf halb weggeschnitten ist. »Leider verpfuscht«, steht in der Handschrift meiner Großmutter auf der Rückseite; und schließlich die siebzehnjährige lächelnde Nora, genannt »kleiner Seidenhase«. Wo ist das Foto seiner Frau, der schönen Charlotte, und wo das Bild jener anderen, Gitta? Hatte er die beiden Aufnahmen mitgenommen auf die Fahrt vom Zuchthaus Remscheid-Lüttringhausen nach Auschwitz? Wieviele Tage war er unterwegs? Fuhr der Zug durch Breslau, seine Heimatstadt?
Wie es wirklich war, werde ich nie erfahren, denn die darüber Auskunft geben können, sind tot, niemand, der ihn auf diesem Weg begleitet hat, ist zurückgekehrt. Was nützte mir auch das noch so genaue Wissen der Umstände, es macht meinen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, nicht wieder lebendig. Und keinen Zweifel gibt es am tödlichen Ausgang der Reise. Das letzte Zeugnis, das ich von ihm habe, ist die Sterbeurkunde, ausgestellt im April 1943 vom Standesamt Auschwitz II. Darin wird bescheinigt, daß der Journalist Dagobert Israel Lubinski am 22. Februar 1943 um 6.45 Uhr in Auschwitz, Kasernenstraße, verstorben ist. Verstorben, das klingt so normal, nach einem natürlichen Tod. In seltenen Fällen machte sich die SS die Mühe, derart amtliche Normalität vorzutäuschen. Meine Großmutter hatte mutig diese Urkunde bei der Gestapo in Düsseldorf verlangt. Die Mehrzahl der ermordeten Juden bekam von den deutschen Behörden keine Totenscheine ausgeschrieben. An welche Adresse sollten die Millionen Scheine auch gesandt werden, wenn es keine Angehörigen mehr gab?
Angefangen hat mein Interesse an diesem Mann mit den Briefen, etwa 100 Blätter, geschrieben aus dem Gefängnis vom November 1936 bis zum Januar 1943. Sie lagen sorgfältig verwahrt im Schreibtisch meiner Mutter, ohne daß ich davon überhaupt wußte.
Erst Anfang der 80er Jahre entschloß sich meine Mutter, die traurige Geschichte ihrer Kindheit und Jugend wieder aufleben zu lassen, indem sie die Briefe ihres Vaters mit der Maschine abschrieb, damit ihre Töchter sie lesen konnten.
Die Briefe nahmen mich sofort gefangen. Der Mann, der sie geschrieben hatte, interessierte mich. Ich fand nicht den Großvater, den ich vielleicht immer vermißt hatte, sondern ich entdeckte Dago, einen erstaunlichen Menschen, widersprüchlich, lebendig und geistvoll, melancholisch und witzig. Er öffnete mir seine innere Welt und ließ mich teilhaben an seiner Verzweiflung, seinem Schmerz, an seiner Kraft und Gelassenheit. Er schrieb diese Briefe in dem letzten und traurigsten Abschnitt seines Lebens, im Polizeigefängnis zwischen den Verhören, im Untersuchungsgefängnis und im Zuchthaus. Doch über seinen Alltag, den er selbst als »niedrigste Stufe des Daseins« bezeichnete, gab er nur sparsam Auskunft. Die Briefe waren für ihn die Möglichkeit, sich davon zu entfernen, zu formulieren, zu fabulieren, trotz widriger Umstände den Geist wachzuhalten. In einer schönen Sprache zwischen Sachlichkeit und Poesie richtete er seine Nachrichten an Frau und Töchter, der einzigen Verbindung zur Welt jenseits der Gefängnismauern. Das Schreiben mußte ihm so vieles ersetzen, das Leben mit der Familie, geistvolle Gespräche mit Freunden und Genossen, seine Arbeit als Journalist. Die Briefe waren sein Tagebuch, sein Selbstgesprächspartner. Er schrieb die Zeilen ohne Hoffnung, jemals wieder bessere Zeiten zu erleben. Seine einzige Hoffnung waren die Briefe selbst. Immer wieder mahnte er seine Frau, sie aufzuheben und sicher zu verwahren. »Gehören zu den Wertpapieren auch die Briefe?« fragte er besorgt, als von einer eventuellen Evakuierung der Familie wegen der Bombenangriffe die Rede war. Noch in seiner letzten Nachricht vor der Deportation mahnte er, seine Schriften an eine sichere Adresse zu bringen. Ich verstand, was diese Blätter beschriebenen Papiers für ihn bedeuteten. Etwas sollte es geben, das ihn überdauerte.
Das ist eine Botschaft, eine Verpflichtung. Dagos Worte scheinen mir auch an mich gerichtet. Seine Briefe haben die Distanz der Jahre zwischen uns überwunden. Sie haben mir eine Tür zur Vergangenheit geöffnet und ich konnte nicht an der Schwelle stehenbleiben. Nun wollte ich alles über meinen Großvater wissen. Was ich fortan las, schrieb und dachte, hatte mit ihm zu tun. Das Thema dehnte sich aus und machte sich breit in meinem Alltag. Bei der Suche nach Dagos Spuren habe ich nicht nur etwas über Geschichte erfahren, ich habe Geschichte erlebt, und es war ganz anders, als ich es mir anfangs vorgestellt hatte.
In alten Zeitungen und Zeitschriften suchte ich nach seinen Artikeln, in Archiven fragte ich nach seinen Prozessakten. Ich schrieb an Rudi Treiber, seinen einzigen noch lebenden Freund, befragte meine Mutter und ihre Schwester. Seine beiden Töchter gaben ihr Wissen nur zögernd her. Schichten von Vergessen und Verdrängen lagerten über den schmerzvollen Erlebnissen ihrer Kindheit und Jugend. Meine Fragen rührten die alten Ängste und Tränen auf, legten verschüttete Erinnerungen frei, und nicht nur Erinnerungen. Immer mehr Dokumente, Briefe, Fotos förderten die beiden Frauen zutage: Ein Bündel Antwortbriefe von Frau und Töchtern an den Untersuchungsgefangenen Lubinski, das er ihnen 1937 zurückgeschickt hatte, der Nachweis der arischen Abstammung meiner Großmutter, der die Deportation ihres Mannes nicht verhinderte, die letzten Briefe von Dagos Geschwistern vor ihrem Abtransport in den Tod. Erstaunlich, was diese Familie, deren Angehörige verfolgt, ermordet wurden, deren Wohnung überdies durch Bomben zerstört wurde, an Zeugnissen der Vergangenheit bewahrt hat.
Indem ich mich mit dem Leben meines Großvaters beschäftigte, geschah etwas mit mir. Vorher war ich eine aufmerksame Schülerin im Fach Geschichte, eine fleißige Studentin auch, die meinte, über die Zeit des Faschismus Bescheid zu wissen. Ich wußte, daß die Geschichte meiner Familie anders verlaufen war als die meiner Mitschüler und Freundinnen, deren Eltern von Soldatenerlebnissen und Kriegsgefangenschaft erzählten. Und doch hatte ich lange Zeit das Gefühl, dies alles habe mit mir nichts zu tun.
Heute wundere ich mich, wie wenig ich gefragt, wie schnell ich mich mit Antworten zufriedengegeben habe. War es das unbewußte Bedürfnis, frei von der Last der Vergangenheit zu leben? War es eine unausgesprochene Übereinkunft, die in meinem Elternhaus herrschte, eine seltsame Mischung aus Wissen, Andeutung und Schweigen, an die ich mich gewöhnt hatte und die meine Neugier lähmte? Lange Zeit sah ich keinen Zusammenhang zwischen der Vergangenheit und dem, was mich in der Gegenwart beschäftigte. Erst die Briefe meines Großvaters haben mich gelehrt, wie nahe mir dies alles geht, was so weit entfernt schien.
Es kommt mir vor, als ob die Worte, die mein Großvater vor 50 Jahren niedergeschrieben hat, mich im richtigen Moment erreicht haben, als ich begann, Fragen zu formulieren, als die Mischung aus Wissen und Schweigen mir nicht mehr genügte. Seine Briefe waren eine Brücke, über die ich gehen konnte, um mich auf eine Suche zu begeben, von der ich lange nicht wußte, wohin sie mich führen würde. Natürlich hat mich die Lust getrieben, eine Geschichte zu entdecken, die mir ganz allein gehören würde. Mit einer besitzergreifenden Vehemenz habe ich mir meinen Großvater bei dieser Suche selbst erschaffen, habe das so entstandene Bild eifersüchtig gegen alle Einwände und Widersprüche seiner Töchter verteidigt. Erstaunt bemerkten die beiden Frauen, wie ihre kindlichen Erinnerungen sich allmählich in mir verselbständigten, wie ich sie anfüllte mit meinen Vorstellungen und Ideen, mit meinem heutigen Wissen.
War Dagobert vielleicht ein Vorbild? Auf jeden Fall hatte er mit den Vorbildern, die ich kannte, nicht viel gemeinsam. In seiner Geschichte gab es viele Rätsel und Widersprüche. Er verkörperte die Ahnung einer anderen Haltung, von der ich bisher nichts gewußt hatte, in der ich mich vielleicht wiederfinden könnte.
Solange ich denken kann, stand sein Bild im Wohnzimmerregal. Er war immer anwesend im Alltag der Familie, ohne daß wir noch bewußt hinschauten oder über ihn sprachen. Aber hin und wieder erfuhr ich etwas über ihn, Splitterchen eines Bildes, das ich mir nicht zusammensetzte: Daß er Kommunist war, daß die Nazis ihn umgebracht hatten. Eine ganz alte Ausgabe des Kommunistischen Manifests stand in unserem Bücherregal, die stammte von ihm. Meine Mutter erzählte, daß er Rosa Luxemburg noch persönlich gekannt hatte. Irgendwann erwähnte sie auch, daß er aus der KPD ausgeschlossen worden war und Mitglied einer anderen Partei wurde, die sich KP Opposition nannte.
Er verdrehte gern Sprichwörter. Meiner Mutter schrieb er ins Poesiealbum: »Wie man sich bettet, so schallt es heraus …«, ohne Rücksicht auf ihre Tränen wegen der Blamage vor den Freundinnen. Er konnte nicht schwimmen. Wasser hat keine Balken, pflegte er zu sagen. Seine Ängstlichkeit muß tyrannisch gewesen sein. Aus der Zeitung las er seinen Töchtern wirkliche oder ausgedachte Unfälle vor, die sich beim Schwimmen und Radfahren ereignet hatten. Außerdem war er prüde und zeigte sich seinen Kindern niemals nackt. Die Mädchen schauten abends heimlich durch das Schlüsselloch der Schlafzimmertür, um endlich zu erfahren, wie ihr Vater ohne Hosen aussah. Am merkwürdigsten fand ich seine Abneigung gegen das Weihnachtsfest. Meine Großmutter brachte in den ersten Jahren ihrer Ehe viel Überredungskunst auf, damit die Kinder ihren Weihnachtsbaum bekamen. Als Kompromiß soll er einen Sowjetstern auf der Spitze verlangt haben. Heute denke ich, daß das auch mit seiner jüdischen Herkunft zusammenhing, von der er sich losgesagt hatte. Aus diesem Blickwinkel war Weihnachten irgendein religiöses Fest, nicht bedeutungsvoller als jene Rituale, die er beschlossen hatte, nicht mehr zu begehen.
Seit wann wußte ich, daß er Jude war? Ich kann es nicht sagen. Früheres und späteres Wissen vermischen sich in meiner Erinnerung. Hatte es mir der alte Mann gesagt, der in unserer Straße wohnte? Dabei hatte der das Wort Jude überhaupt nicht ausgesprochen. Ich kannte ihn, weil er jeden Tag mit seinem Hund spazieren ging. Wir Kinder liefen nebenher, um das Tier zu streicheln. Als einzige durfte ich die Leine halten. Der alte Mann, der hoch gewachsen und weißhaarig eine ebensolche Vornehmheit ausstrahlte wie sein englischer Jagdhund, unterhielt sich ernsthaft mit mir, lud mich sogar in seine Wohnung ein. Zehn oder elf Jahre war ich damals alt und fühlte mich sehr geschmeichelt. Seine Frau kochte uns Kaffee, ich blätterte in Bildbänden. Auf einmal begann der Mann von einer Nacht zu erzählen, in der die Häuser gebrannt hatten. Nicht alle Häuser, offenbar nur einige. Er schien sehr erregt, beteuerte, wie leid es ihm getan hatte, als eure – dabei wies er auf mich – Kaufhäuser in Flammen standen. Ich beobachtete ihn aufmerksam und verwundert, aber ich hatte keine Ahnung, wovon die Rede war. Seine Hände fuhren in Zickzack-Bewegungen durch die Luft, ahmten den Flug der brennenden Stoffballen nach. In seinen Augen sah ich den Widerschein jenes Feuers von damals. Er müsse sich irren, widersprach ich, meine Eltern hatten nie irgendwelche Kaufhäuser besessen. Ach, antwortete er mit einer Handbewegung, natürlich habt ihr alle Kaufhäuser besessen und versicherte noch einmal, wie leid es ihm getan hätte. Ziemlich verwirrt ging ich nach Hause und erzählte meinen Eltern davon. Die wechselten einen bedeutungsvollen Blick miteinander und erklärten mir, der Mann habe von den jüdischen Kaufhäusern gesprochen. Weil wir Juden seien, meinte er offenbar, auch wir hatten Kaufhäuser besessen. Das war komisch und beklemmend zugleich. Überhaupt, was sollte das heißen, wir sind Juden? Ich war doch wie alle anderen.
Den alten Mann mied ich seitdem und sah ihn nur von weitem. Die Nachbarn erzählten, früher habe er das goldene Parteiabzeichen der NSDAP am Jackenaufschlag getragen. Aber es war nicht deshalb. Ich ging nicht mehr hin, weil ich enttäuscht war. Ich hatte angenommen, um meiner selbst willen angesprochen und eingeladen worden zu sein. Dabei hatte ihn etwas anderes bewegt, ein Gefühl, das ich nicht benennen konnte und das mir unheimlich war.
//
Im Januar 1943 starb der jüdische Antifaschist Dagobert Lubinski in Auschwitz. Jahrzehnte nach seinem Tod liest seine erwachsene Enkelin die Briefe, die er über sechs Jahre aus dem Zuchthaus an seine Frau und die Töchter geschrieben hatte.
Dagobert Lubinski war Kommunist, und er war Jude. Die letzten Jahre seines Lebens, vom November 1936 bis zum Februar 1943, verbrachte er im Gefängnis, im Zuchthaus, im KZ. Er ist in Auschwitz zu Grunde gegangen, weil er Widerstand leistete gegen das nationalsozialistische Regime, das ihn vernichtete, weil er politischer Gegner und Jude war. Aber auch die Antifaschisten schwiegen ihn tot, denn er gehörte zu der Minderheit in der KPD, die nicht der aus Moskau vorgegebenen Linie blind folgen, sondern Ideologie und Vernunft in Einklang bringen wollte.
Die Männer und Frauen der KPD-Opposition (KPO), wie sich die Gruppe nannte, sind auch nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes in der DDR verfemt geblieben, in der Bundesrepublik waren sie ohnehin vergessen, denn der Weststaat brauchte zu seiner Legitimation nicht den Widerstand von Kommunisten.
Dagobert Lubinski wäre auch spurlos aus der Geschichte verschwunden, wenn sich nicht seine Briefe und Kassiber in der Familie erhalten hätten. Annette Leo hat in den 80-er Jahren die Spurensuche aufgenommen und 1991 das Ergebnis, dieses Buch »Briefe zwischen Kommen und Gehen«, zum ersten Mal veröffentlicht. Als Enkelin legitimiert und als Historikerin gerüstet reist die DDR-Bürgerin Annette Leo auf der Suche nach Dagobert Lubinski, dem erwerbslosen Journalisten und vormaligen Wirtschaftsredakteur des KPD-Organs »Freiheit«, der sich 1928 von der KPD getrennt hat, der 1933 zum ersten Mal in nationalsozialistische »Schutzhaft« gerät, nach Düsseldorf. In Archiven und Gesprächen mit Zeitzeugen, bei Lokalterminen sichert sie die spärlichen Zeugnisse vom Leben ihres Großvaters. Wichtigste Quelle sind die Briefe, die sie durch andere Dokumente und Recherchen ergänzt. Die letzte Reise führt sie nach Auschwitz, der letzten Station Dagobert Lubinskis. Dort ist er laut standesamtlicher Urkunde am 22. Februar 1943 um 06.45 Uhr »verstorben«.
Annette Leos Bericht, dessen Roter Faden der schriftliche Nachlass des Großvaters in der Familie bildet, ist die dichte Beschreibung eines vorbildlichen Menschenlebens, vorbildlich in der Treue, Moral und Unbeirrbarkeit, in der Dagobert Lubinski zu seinen Idealen stand, vorbildlich in der Sorge um die Familie in aussichtsloser eigener Not, vorbildlich im Widerstand gegen nationalsozialistische Barbarei und gegen jede andere Form von Dogmatismus.
Die Geschichte des Dagobert Lubinski lehrt viel über Faschismus und Antifaschismus und viel über Selbstbehauptung und aufrechten Gang, und diese Geschichte ist ein Dokument der Humanität.