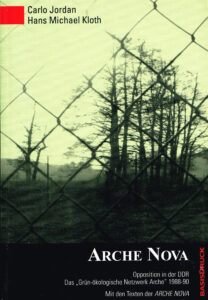Aus Ulrike Steglichs Perspektive sind es diese Bewohner, die die Erzählung der Stadt ausmachen. Wer genau hinschaut und zuhört, entdeckt überall Spuren des Wandels: in den kleinen Geschichten neben dem Skandal, im Detail neben hochfliegenden Plänen, im Hintergrund der bekannten Bilder. Sicher ist hier immer nur eines: Es kann nie langweilig werden.
Eine Zwischenbilanz nach zwei Jahrzehnten, bevor in Berlin vielleicht wieder Geschichte gemacht wird.
VORWORT
Paul in Unterhosen. Gedichte am Bauzaun. Fledermäuse im Palast der Republik? Die Geschichten von Ulrike Steglich resümieren den Wandel der Berliner Mitte in den letzten zwanzig Jahren. Ihr Buch »Universum Ackerstraße« ist der Versuch einer Stadtbeschreibung in Geschichten, Reportagen und Porträts, ergänzt durch Fotoserien von Klaus Bädicker, Christoph Eckelt und Mirko Zander. Die drei Fotografen dokumentieren seit vielen Jahren mit ihren Stadtbildern die Veränderungen Berlins. Seit 1989 erlebte Berlin gravierende Umwälzungen. Wende, Mauerfall und Wiedervereinigung, Umbau, Neubau, Sanierung, leidenschaftliche Debatten, alltägliches Zusammenwachsen: Solche Kontraste und Reibungsflächen machen die eigentliche Anziehungskraft Berlins aus. Sie zeigen sich in politischen Prozessen und städtebaulichen Veränderungen ebenso wie im alltäglichen Leben der Bewohner, die mit Geduld, Pragmatismus und lakonischem Witz den permanenten Wandel bewältigen. Viele Akteure wirken an der Entwicklung mit: nicht nur Landes- und Kommunalpolitik sowie Investoren, sondern auch Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften, Bürgerinitiativen und Vereine oder ehrenamtlich Tätige. Letztlich sind es die Menschen, die die Erzählung der Stadt prägen. Und wer genau hinschaut, entdeckt die kleinen
Geschichten neben den großen, Unspektakuläres neben dem Skandal und den hochfliegenden Plänen, Erfolge neben Krisen. Sicher ist eines: Langweilig wird es hier nie.
Leseprobe:
POESIE AM BAUZAUN
Seit sie im letzten Jahr die Schule nebenan abgerissen haben,
entwickelt die Brache ein interessantes Eigenleben.
Von meinem Fenster aus sah ich zu, wie auf dem planierten,
umzäunten Areal im Winter die Pfützen einfroren und wie
sich im Frühling das erste Grün hervorwagte. Weil es von
niemandem dabei gestört wurde, entwickelte es sich munter.
Erst kamen Löwenzahn und Gräser, dann blühten im Sommer
Klatschmohn, Kornblumen, wilde Kamille und Sonnenblumen.
Kleine Ahorne und Götterbäume sprossen. Sie werden
nicht sehr groß werden, denn die Fläche ist Bauland,
aber immerhin. Man freut sich über das bisschen Anarchie,
während ringsum das Altbauviertel immer schicker und teurer,
ordentlicher und öder wird.
Jeden Morgen laufe ich mit meinen Söhnen auf dem Weg
zur Schule an der kleinen Brache vorbei. Irgendwann fiel
mir ein grüner Plasteschraubdeckel am Zaun auf. Er war
sorgfältig mit kleinen Plastikdrähten an den Maschen befestigt,
darauf war mit Filzstift geschrieben: JA. Ein Stück
weiter ein neues Fundstück: eine alte Tonkassette, auf dieselbe
Weise aufgehängt, beschriftet nur mit dem Wort WENN.
Es wirkte irgendwie liebenswürdig. Wenn es Kunst war –
und Kunst lauert hier inzwischen an jeder Ecke, man muss
höllisch aufpassen, dass man nicht ständig reinlatscht –, so
war es zumindest keine, die einen hysterisch anbrüllte, dass
man sie gefälligst als solche anzubeten habe.
Zwei Tage später warteten neue Überraschungen am
Zaun: Ein Einmachgummi, auf dem stand: ICH SÄE WAS,
WAS DU NICHT SIEHST. Um die Ecke dann ein kleines,
eng beschriebenes Stück Pappe. Langsam fühlte ich mich
wie Alice im Wunderland. Ich las:
»Fette Geister auf der Mauer /
Luegen liegen auf der Lauer /
Schmeißen Beeren Zapfen Blaetter /
Spielen Rache Engel Retter /
Rufen laut luis /und leise /
Achtung! Hundescheiße«.
Das warf mich endgültig um. Es war die schönste Hundescheiße-
Poesie, die ich je gelesen hatte, wenn ich überhaupt
mal Poesie gelesen haben sollte, in der Hundescheiße
vorkam. Es war einfach großartig. Zum Niederknien schön
(Achtung, Hundescheiße!). Ein stiller Poet, dessen Witz an
Max Goldt erinnerte oder an Robert Gernhardt.
Die Kassette verschwand zuerst. Ein paar Tage später war
dann auch das Gedicht weg. Vielleicht ein gieriger Sammler,
vielleicht ein vernichtungsfreudiger Ignorant oder ein Ordnungsfanatiker,
der keine Zettel an Zäunen duldete.
Es schien den Poeten nicht zu entmutigen. Es dauerte
nicht lange, da hatte er eine liebevoll in zwei Spiralen aufgedröselte
Klopapierrolle aufgehängt, auf der stand:
ZWEISEELENVERKLEBER.
Das erklärte einiges.
Dann passierte nichts mehr, abgesehen davon, dass die Sonnenblumen
wuchsen. Der Zaun schwieg. Mir fiel auf, dass
ich die geheimnisvollen Zaun-Botschaften vermisste. Und
ich grübelte, wie das mit dem Zweiseelenverkleber wohl
ausgegangen war. Erst an einem kühlen Herbstabend, als ich
schon nicht mehr damit rechnete, gab es Neuigkeiten. Am
Zaun hing ein flacher Stein, befestigt mit den vertrauten Plastikschlaufen,
beschrieben mit schwarzem Tintenstift.
Juten Morgen /
schoene Frau /
dass ick dir wiederschau /
ick hab dir ueberall jesucht /
hab alle Welt in Arsch jeflucht.
Ich ging beruhigt nach Hause.
leseprobe korr 19.11.2010 10:00 Uhr Seite 3
MENSCHEN IN DER ACKERHALLE
Ein Paralleluniversum zu den Hackeschen Höfen
Tommi sitzt auf dem Boden der Eingangsschleuse zur
Ackerhalle. Gelegenheit, zusammen eine Zigarette zu
rauchen und nach Neuigkeiten zu fragen. Tommi hat jetzt
statt einem zwei Hunde. Die liegen da, dösen und sind
harmlos wie zu groß geratene Welpen. Sonst gibt es nichts
Neues. Tommi ist etwa zwanzig, wird gemeinhin als Punk
bezeichnet und hatte zusammen mit anderen ebenso Jungen
und noch Jüngeren einen langen, kalten Winter hindurch in
einem leer stehenden Haus gewohnt, um das seit Jahren ein
Abrissstreit tobte. Irgendwann im letzten Sommer rückten
Polizeibeamte aus dem benachbarten Revier an, um zwei
der zeitweiligen Bewohner zu suchen. Wegen nicht bezahlter
Schwarzfahrer-Strafgebühren etwa, die dann abgesessen
werden müssen.
Es waren nicht mehr viele in dem Haus. Einer, der gerade
mit einem kleinen Hund zum Tierarzt wollte, musste seinen
Ausweis holen. Währenddessen taumelte sein abgemagerter
Schützling verloren zwischen den Uniformierten
lang und zog ein dünnes, gelbliches, stinkendes Rinnsal
über den Bürgersteig. Die Beamten sahen dem struppigen
Bündel mit einer Mischung aus Ekel und Mitleid hinterher.
Schließlich siegte bei einem die Tierliebe: Er fing an, dem
Punk Ratschläge über Ernährung und Krankenpflege junger
Hunde zu geben.
Tommi kommt nicht täglich, aber immer mal wieder an
die Ackerhalle, meistens sitzt er an dem Ausgang zur
Ackerstraße hin. Der Ort ist strategisch günstig zum
Schnorren: »’n bisschen Kleingeld« haben die meisten, die
herauskommen. Schon wegen der obligatorischen Münze
im Einkaufswagen.
Am anderen Ausgang, dem zur Invalidenstraße, sitzen
zwei Mädchen. Der Gegenwert für ein bisschen Kleingeld ist
ein entwaffnendes Lächeln. Das mit dem Gegenwert stimmt
nicht ganz: Das Lächeln kommt auch bei einer Absage. »Es
ist ja okay, wenn jemand nichts gibt«, hat mal einer gesagt.
»Was nervt, ist, wenn sie dich nicht mal ansehen.«
Ein Stück weiter steht Walter. Walter hält den Leuten die
Tür auf wie ein Portier am Eingang zu einem Nobelladen.
Eine immer gleiche Bewegung, auch der Blick ist wie in
Trance. Manche eilen durch die aufgehaltene Tür und
schauen nicht hoch. Manchen, denen der Anblick neu ist,
rutscht ein überraschtes Danke heraus. Walter ist ein Stoiker.
Das Problem, vor dem er stand, als die Flügeltüren vor
kurzem gegen sich automatisch öffnende Schiebetüren ausgetauscht
wurden, hat er schnell und flexibel gelöst. Jetzt
setzt er wie ein Zauberer mit einer kleinen Handbewegung
die Automatik in Gang: Sesam öffne dich. Wer verliert
schon gerne einen Job?
Macht Walter das mit der Tür, weil er nichts anderes zu
tun hat, aber auch irgendwie nützlich sein will? Ein mögliches,
eigentlich naheliegendes Motiv wird erst klar, als
Rudi, sein nicht so entrückter, etwas pragmatischerer Kumpel,
auf die Punks schimpft. Die für nichts kassieren, während
Walter trotz Türöffnen leer ausgehe. Tatsächlich beläuft
sich der Gegenwert für das Türöffnen fast auf null.
Das liegt nicht an den Punks, sondern eher daran, dass Walter
stumm bleibt.
Dass Solidarität da unten üblich sei, ist naive Romantik.
Konkurrenzdenken ist nicht nur eine Sache von Firmenbossen.
Für die alteingesessenen Älteren, die durchs Netz fallen,
sind die aus allen möglichen Ecken weggelaufenen
Kiddies manchmal auch Blitzableiter.
Auf einen heruntergelassenen Rollladen außen an der
Ackerhalle hat jemand gesprüht: Konsumiert mehr, dann lebt
ihr weniger. Einem anderen fiel ein: … dann liebt ihr das
Meer. An der Tür seufzt eine Frau, mit drei schweren Einkaufstüten
kämpfend: »So ist das mit drei Gören.« Konsum?
Die Ackerhalle war früher eine klassische Berliner Markthalle.
Etwas von diesem Charakter war noch zu DDR-Zeiten
spürbar, auch wenn schon eine Kaufhalle eingebaut
war. Drum herum gab es noch diverse Stände: Fisch, Eis,
Obst und Gemüse, Kurzwaren, Handwerkerbedarf …
Die seltsam zwittrige Ausstrahlung zwischen Trübsinn
und Vertrautheit änderte sich auch nicht, als über Nacht
Westwaren die Regale füllten. Erst mit dem Umbau 1991
hatte die Ackerhalle ihre Wende. Zur Bolle-Eröffnung gab
es Bratwurstdunst, Blasmusik und eine lange Schlange, die
Neugierigen rammten sich die überdimensionierten Einkaufsgefährte
in die Hacken. Der Denkmalschutz sorgte für
die allerletzte Erinnerung an eine Markthalle: Geht der
Blick nach oben, kann man sich mit etwas Fantasie das frühere
Treiben unter den eisernen Säulen- und Trägerkonstruktionen
zwischen den Backsteinfassaden und dem
durch das Glas fallenden Licht noch vorstellen.
Sieht man frühere Markthallen als Konsum- und kommunikative
Orte gleichermaßen, so sind die Funktionen
jetzt getrennt. Der eingebaute Supermarkt ist eine schlichte
Versorgungseinrichtung, in der man zwar Bekannten begegnet,
aber ansonsten das Notwendige besorgt und basta.
Ab und an bestaunt man flüchtig eine skurrile Werbeaktion,
etwa eine Kabeltrommel mit aufgerollten Würsten.
Wie platt gepresst vom sich breitmachenden Hier-gibtes-
fast-alles-Land findet sich am Rand hinter den Kassen
ein Mischmasch ergänzenden Handels: Zwei Vietnamesen
verkaufen Klamotten, Schlüsselservice und Waschmaschinen,
Groschenromane, Dessous und Pantoffeln, daneben
ein Gemischtwarenladen, dessen Sortiment vom Sofabezug
bis zu Batterien reicht. Der obligatorische Bäcker, Flaschenannahme,
Lotto und Zeitungen.
Die Kommunikation ist mittlerweile an die Peripherie
gezogen. Die dünne Frau, die fast schon zum Ackerhallen-
Inventar gehört, hat ihren Lottoschein abgegeben und plänkelt
vor der Tür mit Walter und Rudi. Kurti ist auch da.
Kurti steht – klein, weißhaarig, alt – in seinem blauen Dederonkittel
und mit einem dreckigen Leinenbeutel vor der
Tür und brabbelt wie immer. Einen Kaffee lehnt er nicht ab
und eine Zigarette auch nicht. Kurti nuschelt, und deshalb
ist die Kommunikation nicht ganz einfach. Elli ist in ein
Heim gekommen, erzählte er irgendwann. Elli wohnte bei
Kurti im Vorderhaus, machte ihn immer mal an und konnte
ohne Ende Geschichten über die Straße erzählen, in der sie
schon ewig wohnte. Auch über die Ackerhalle. Es war
spannend, ihr zuzuhören. Jedenfalls auf ihrem Balkon. Ihre
Wohnung hatte Elli längst nicht mehr im Griff, der Geruch
erinnerte an jenes Krankenpflegeheim mit dem miesesten
Ruf in Ostberlin.
Weg ist auch die Frau, die vor der Ackerhalle die BZ verkaufte
und mit der Kurti seinerseits immer ein bisschen
flirtete. Klein, drahtig, dunkelhaarig, die Gesichtszüge fast
wie gemeißelt – eine verwitterte, respekterzeugende Erscheinung,
der nicht mal die alberne BZ-Mütze Abbruch
tat. Manchmal verkaufte Kurti für sie weiter, wenn sie ein
paar Besorgungen machen musste.
In jenem Winter, als Tommi und seine Kumpel Unterschlupf
in dem leeren Haus fanden, standen Walter, Rudi
und ein paar andere auch öfter tagsüber in dem kleinen
Geldautomaten-Raum neben dem Eingang. Geldkarten hatten
sie zwar nicht, dafür ein paar Dosen Bier. Gestört hat
sich auch keiner daran. Nicht hier.
»Was – DA gehst du rein?« Ein Student, nach der Wende
zugezogen, ist entsetzt. Die Imbiss-Stube gegenüber vom
Sparkassenraum, die auch noch zur Ackerhalle gehört, ist
nicht nur für ihn ein suspekter Ort. Dabei ist sie eigentlich
eher ein Ort der sozialen Stabilität. Hier frühstücken Bauarbeiter
Buletten und Spiegeleier (Baustellen gibt es genügend
im Umkreis), trinken Rentner am Vormittag Kaffee
oder Bier und schwatzen miteinander. Ab und an leistet
sich auch die Parkbankgemeinschaft von nebenan hier ein
Bier, obwohl es aus der Büchse und der Ackerhalle weniger
kosten würde. Hier essen die, die gerade ihren Wochenendeinkauf
gemacht haben, und auch ein paar Ackerhallen-Angestellte
im Jackett schnell, billig und warm.
Der Raum ist klein, geräuschvoll und lebhaft. Zwischen
Tischen, Abstellwagen, Tresen, Stammtisch, Spielautomaten,
Küche, Klo, Werbeschildern und laufendem Fernseher
bleibt wenig Platz. Spätestens nach dem dritten Besuch sind
die immergleiche Bestellung und das Gesicht dazu bei den
Frauen hinter der Theke registriert. Krach gibt es hier nicht.
Was natürlich auch daran liegen kann, dass die Öffnungszeiten
mit denen der Ackerhalle identisch sind. Aber entscheidender
ist: Man passt auf komische Weise aufeinander auf.
»Wer macht’n hier die Asche uff’n Boden?« Ein halbherziger
Erziehungsversuch der Tresenfrau, die gerade Feierabend
macht. Der alte Mann bleibt ungerührt: »Keener.«
Ihre Kollegin hilft ihm anschließend beim Zeitvertreib am
Flipper: »Risiko musste drücken. Und jetzt Annahme.« –
»Habickja.« – »So. Spiel weiter. Aber dit mit der Asche
stimmt.« – »Mach ick nachher weg.«
Ein paar Schritte neben der Imbiss-Stube wird umgebaut.
Früher war das hier ein kleiner Pelzladen. Der Anblick
des Ladens weckt die Erinnerung an Professor Karl
Schlögel, der ein emphatisches Eröffnungsreferat zu jenem
»Stadtforum« gehalten hatte, auf dem mit großem Paukenschlag
das »Planwerk Innenstadt« präsentiert wurde.
Schlögel hatte über den Wandel osteuropäischer Städte gesprochen
und dabei das »Ende der Stadt als staatliche Veranstaltung
und die Wiedergeburt der Bürgerstadt« gefeiert:
»Banken, die zu Mensen und Museen umfunktioniert worden
waren, werden wieder Banken; ein mondänes Pelzgeschäft,
das zu einem Fischladen geworden war, wird wieder
ein Pelzgeschäft.«
Na gut, mondän war der Pelzladen nie. Jedenfalls ist er
kurz nach Schlögels Vortrag eingegangen. Jetzt zieht dort
ein Döner-Imbiss ein. Er heißt »Multikulti«. (1997)
FLEDERMÄUSE IM PALAST
Wir schwören: Alles fing wirklich mit Naturschützern
an, mit echten. An jenem Tag nämlich, als eine junge
Frau auf der offenen Redaktionssitzung unserer Stadtzeitung
»scheinschlag« erschien und von einer neuen Gruppe
der Naturschutzjugend erzählte – eine der ersten Aktionen
sollte das Anlegen eines Mini-Biotops sein.
Irgendwie fielen uns dann die Fledermäuse ein, die durch
die zahlreichen Sanierungen aus den Altbauten in Berlin-
Mitte vertrieben wurden. Warum sollte man die eigentlich
nicht im seit Jahren geschlossenen Palast der Republik vermuten?
Den Fledermäusen wäre geholfen, und es käme mal
etwas Humor in die festgefahrene Debatte um Abriss oder
Erhalt des heiß umkämpften Ostberliner Gebäudes.
Pünktlich am Donnerstag erschien die nächste »scheinschlag
«-Ausgabe mit einer Meldung auf Seite 2. Darin forderte
ein Interessenverband der Naturschützer Berlins
(INB), den Palast der Republik stehen zu lassen, weil sich
dort inzwischen Fledermäuse angesiedelt hätten, von denen
es nur noch 16 Arten in Berlin gäbe und die deshalb streng
geschützt seien. Der Palast müsse deshalb zum Biotop ausgebaut
und unter Naturschutz gestellt werden, was zudem
dem Anspruch einer ökologischen Stadtentwicklung gerecht
werden würde.
Am Freitag klingelte das Telefon. Am Apparat war der Redakteur
einer großen, seriösen Berliner Tageszeitung, der
unsere Meldung spannend fand und fragte, ob wir ihm denn
bei der Recherche helfen könnten. Kollegen wollten wir eigentlich
nicht verprellen. Vorsichtig deuteten wir an, dass
wir ja gemeinsam den INB gründen könnten. Er freute sich.
Wenn wir dann eine schöne offizielle Pressemitteilung für
ihn hätten, meinte der humorvolle Kollege, würde er gern
mitspielen.
Die Pressemitteilung des INB erreichte ihn am Samstag per
Fax. Sie war liebevoll layoutet, mit hoppelnden Häschen
und einem Hirsch im Logo – was die Sonderzeichen unserer
Tastatur eben so hergaben. Das fand wiederum ein Büro-
Kollege so gelungen, dass er im Vorbeigehen empfahl,
das Fax doch auch noch an die Nachrichtenagentur ADN
abzusetzen. Das war Samstagabend.
ADN arbeitet verdammt fix. Keine 12 Stunden später nahmen
wir am Sonntagmorgen, nichts Böses ahnend, die Spitzenmeldung
der Nachrichten eines Berliner Dudelradios
zur Kenntnis: Fledermäuse im Palast! Der Slogan des Senders:
Immer auf den Punkt informiert.
Etwa zwei Stunden später klingelte das Telefon. Ein Redakteur
des Berliner Kuriers war am Apparat, der aus der
ADN-Meldung eine »größere Geschichte« machen wollte:
Ob wir denn jemanden vom INB auftreiben könnten? Der
Redakteur war hörbar so unter Zeitdruck, dass hektisch drei
Bekannte herbeitelefoniert werden mussten, die als »INBAktivisten
« Auskunft über Fledermäuse, Artenschutz und
Einflugschneisen gaben und auch noch für ein Foto antreten
durften – vor dem Palast natürlich.
Am Montagmorgen kauften wir ahnungsvoll Berliner Tageszeitungen
von BZ bis ND: ALLE brachten die Meldung,
jede in ihrem Stil. Der Berliner Zeitung, die eine sachliche
Nachricht druckte, hatte die Idee der ökologischen Stadterneuerung
besonders gefallen. Vielleicht weil es so seriös
klang. Wir freuten uns auch über das Foto und die vorbildliche
»größere Geschichte« im Kurier, besonders aber über
die Überschrift: »Naturschützer fordern: Macht den Palast
zum Fledermaus-Asyl!«
Doch nicht nur in den Printmedien flederte es heftig, auch
Hörfunk und Abendschau erwärmten sich für das Thema.
Den ganzen Montag über hielten uns die putzigen Tierchen
auf Trab, das Telefon klingelte ununterbrochen: RTL wollte
drehen, der NDR wollte ein Interview. Nur bei der Berliner
Zeitung war inzwischen ein Redakteur misstrauisch geworden
und hakte so intensiv nach, dass wir eiligst unseren
Bonner Biologie-Experten – ein Bekannter einer Bekannten
– anrufen mussten, der dann mit dem von der Berliner
Zeitung aufgebotenen Naturschützer in den Expertenstreit
treten konnte.
Inzwischen mussten wir um die Unversehrtheit unserer
Tischplatten fürchten, in die die Beteiligten vor Lachen immer
wieder beißen wollten. Außerdem waren wir langsam
selbst nicht mehr sicher, dass es keine Fledermäuse im Palast
gab. Schließlich konnte man weder das eine noch das
andere beweisen – es kam ja niemand hinein in das umstrittene
Objekt, um die Sache zu überprüfen.
Irgendwann wuchs uns die Angelegenheit über den Kopf:
Wir waren seit mehr als einer Woche schlichtweg nicht
mehr zum Arbeiten gekommen. An diesem Punkt wollten
wir den Spaß beenden. Also erging an die Kollegen wieder
ein Fax mit Hirsch und hoppelnden Häschen: diesmal, um
die Geschichte aufzulösen. Die eingeweihte TAZ bekam
grünes Licht für einen Outing-Artikel, der NDR sendete ein
Enthüllungsinterview und eine Satirezeitung amüsierte sich
auf drei Seiten über den Coup. Bloß bei ADN soll eine Redakteurin
ziemlich sauer gewesen sein.
Ein paar Wochen später blätterte ich in dem Promi-Klatschheftchen
GALA. Unter der Rubrik »Worüber Deutschland
spricht« prangte die Überschrift: »Fledermäuse im Palast«.
Einige Jahre später konnten einige Mitglieder des Abgeordnetenhauses,
wohlverpackt in Schutzanzügen, die Asbestsanierung
des geschlossenen Palastes begutachten. Bernd
Holtfreter (der im Mai 2003 starb) hatte noch an der Besichtigung
als einer der baupolitischen Begutachter für die
PDS teilgenommen. Er berichtete mir hinterher, Fledermäuse
hätten sie im Palast nicht gefunden. Aber Marderkacke.
– Bernd mochte gute Pointen.
(1996/2009)